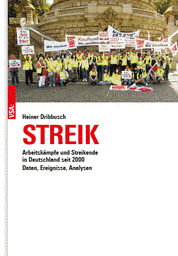Diskussion mit Hans Modrow
Gegen nationale Verantwortungslosigkeit

- Hans Modrow und Helmut Kohl am 2. Februar 1990 am Rande des »World Economic Forum« in Davos.
(erschienen in Heft 10-1990 von Sozialismus, S. 5-9; für Sozialismus diskutierten Joachim Bischoff und Hasko Hüning)
SOZIALISMUS: Die Bonner Anschluss- und Einverleibungspolitik mündet – so muss man es mittlerweile formulieren – in einer Katastrophe: Zusammenbruch der Ökonomie in Industrie und Landwirtschaft, rasanter Anstieg der Massenarbeilslosigkeit, wachsende soziale Spannungen, zunehmenden Existenzängste. Von der Regierung de Maizière erwartet kaum noch jemand Besserung. Du wirfst ihr Konzeptionslosigkeit vor, charakterisierst ihre Entwicklung als Übergang von einer Übergabe- zu einer Kapitulationspolitik. Umso mehr stellt sich die Frage, wie zu erklären ist, dass sich diese Politik durchsetzen konnte.
MODROW: Da kann man nicht nur in der aktuellen Situation ansetzen, sondern muss einen etwas breiteren Bogen spannen.
Zunächst möchte ich betonen, dass niemand das Scheitern, den Zusammenbruch des Modells leugnet, das 40 Jahre die Entwicklung der DDR bestimmt hat. Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich in der DDR eine überzentralisierte, bürokratische Form der Planwirtschaft herausgebildet hatte, die ökonomische Aktivitäten reglementierte, statt sie zu fördern, zu entfalten. Hinzu kam, dass das Konzept der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik darauf hinauslief, ein höheres Sozialprodukt zu verteilen, als erwirtschaftet wurde. Das führte dazu, dass die Akkumulation mehr und mehr an den Rand gedrängt und die Modernisierung der Wirtschaft derart behindert wurde, dass letztlich die volkswirtschaftliche Reproduktion nicht mehr gesichert war. Unter Mittag wurde dies kaschiert durch die Zurschaustellung und Konzentration auf einige wenige moderne Technologien – den berühmten Mega-Chip z.B.; in einer Mischung von Selbsttäuschung, Inkompetenz und bewusster Manipulation redete man davon, Weltniveau erreicht zu haben, obgleich wir meilenweit davon entfernt waren.
Das sind einige der grundlegenden Ursachen für die aktuellen Probleme. Die Fehler und Fehlentwicklungen müssen intensiv und gründlich aufgearbeitet werden. Dies umso mehr, als heute bereits wieder sehr oberflächlich über die 40 Jahre DDR geurteilt wird. Verdrängt wird, dass wir im Vergleich mit den anderen so genannten sozialistischen Staaten immer als der Staat mit der größten Effizienz, mit der solidesten ökonomischen Grundlage galten. Jetzt wird so getan, als ob davon nie etwas existiert habe.
Meine Position war, dass man in der Übergangsphase, nach dem Zusammenbruch des alten Systems, versuchen musste, Elemente der Perestroika für die DDR zu nutzen. Das war die Grundüberlegung in meiner Regierungserklärung von 17. November, die auch von der CDU – die ja unter ihrem neuen Vorsitzenden Lothar de Maizière der Regierung angehörte – getragen wurde. Die Öffnung der Grenze am 9. November von DDR-Seite aus – über die völlig ungenügende Vorbereitung dieses Schrittes durch die damalige SED-Führung unter Krenz will ich mich hier im Einzelnen nicht äußern –, führte auch zunächst dazu, dass der politische Druck etwas nachließ, bevor die Öffnung der Grenze von Seiten der BRD am 22. Dezember uns vor neue massive ökonomische Probleme stellte. Dennoch gelang es uns im 1. Quartal 1990 im großen und ganzen noch, die Reproduktionsprozesse aufrechtzuerhalten; zwar mit leicht rückläufiger Tendenz, aber bei weitem nicht vergleichbar mit dem tiefen und schnellen Absacken, wie wir es jetzt beobachten können. Die Gewinnabführung konnte weitgehend aufrechterhalten und damit die staatlichen Finanzen stabilisiert werden.
Die ständigen Angriffe seitens der Bonner Regierung, die Forderungen, umfassend und beschleunigt zu privatisieren und die Wirtschaft von allen zentralistischen Strukturen frei zu machen, die sich häufenden Erklärungen, westdeutsche Investoren würden erst nach Beseitigung zentralistischer Hemmnisse kommen, machten dann aber bald klar, dass sich eine Perestroika in der DDR nicht mehr verwirklichen ließ, so dass wir uns darauf konzentrierten, Bedingungen und Voraussetzungen für eine schrittweise Anpassung einer Wirtschaftsgemeinschaft herbeizuführen. Das war das Konzept, an dem die strategische Gruppe um Christa Luft immer wieder gearbeitet hat.
Deine These ist also, dass die ökonomischen Grundlagen für eine Politik des schrittweisen Übergangs durchaus vorhanden waren. Demgegenüber hast du an anderer Stelle einmal gesagt, dass der Versuch, aus der Mark der DDR allmählich eine Hartwährung zu machen, u.a. an der zunehmenden Schwäche der DDR-Wirtschaft gescheitert sei. Ein Widerspruch.
Nur scheinbar. Die Schwäche unserer Wirtschaft, gerade in Konkurrenz zur Wirtschaftsmacht der Bundesrepublik, ist offenkundig. Das heißt aber nicht, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch gestanden hätte. Sie wurde und wird durch die jetzt praktizierte Politik erst dahin getrieben. Der entscheidende Punkt ist: Wie kann man gegensteuern? Nicht nur in der Wirtschaftspolitik, auch auf ökologischem Gebiet, in den stark belasteten Ballungsgebieten, wo sich zeigte, dass die Menschen immer weniger bereit waren, mit uns mitzugehen. Ich habe Sonderkommissionen eingesetzt, die sich mit solchen Strukturproblemen beschäftigten. Wir begannen, Umschulungsmaßnahmen zu erarbeiten, um auf ökologisch sinnvolle Produktionen umzustellen. Wir haben zeitig Arbeitsämter geschaffen, die Vorruhestandsregelung verabschiedet – alles Maßnahmen, die arbeitsmarktpolitisch zu einer ansatzweisen Stabilisierung führten. Und weil wir das alles gar nicht nur in eigener Verantwortung machen konnten, kam es am 28. Januar zur Regierung der nationalen Verantwortung unter Teilnahme von Vertretern der oppositionellen Parteien und Bürgerrechtsbewegungen.
Nach dem 18. März konnte von Gestaltung des Übergangs keine Rede mehr sein. Die Politik der schnellen Wirtschafts- und Währungsunion schuf ein Vakuum, führte dazu, dass die ökonomischen Kreisläufe zunehmend ins Stocken kamen und dem Staat die Finanzquellen entzogen wurden. Weder die Regierung de Maizière, noch die vielen Rat- und Auftraggeber aus der BRD, die in den Wirtschafts- und Staatsapparat einzogen, haben konzeptionell etwas zuwege gebracht – das meine ich mit dem Stichwort Kapitulationspolitik. Selbst Maßnahmen der Regulierung und Steuerung des Marktes, wie sie in der Bundesrepublik oder in der EG – z.B. im Bereich der Landwirtschaft – üblich sind, sind gar nicht erst in Angriff genommen worden. Stattdessen wird konzeptionslos nurmehr spontan auf die jeweilige Marktsituation reagiert.
In deiner in der ZEIT veröffentlichten Bilanz der Zeit von November 1989 bis März 1990 lauten die Leitlinien der Regierungspolitik: Schaden begrenzen, Wirtschaft in Gang halten, Versorgung sichern. Heißt Perestroika für dich also näher: Gestaltung eines schrittweisen Übergangs von der Kommandowirtschaft zu einer sozial regulierten Marktwirtschaft?
Das war die Aufgabe, die wir uns gestellt hatten. Wir gingen z.B. von der Einschätzung aus, dass wir aus eigener Kraft keine rasche Modernisierung auf breiter Front hinbekommen würden. Deshalb war unser Ansatz, Kapitalbeteiligungen, Joint Ventures zu ermöglichen, aber unter Beibehaltung der Dominanz staatlichen Eigentums. Einen Ersatz für die Wirkung von Angebot und Nachfrage, Wert und Preis gibt es nicht. Dieser Tatsache muss auch jeder lenkende Eingriff in die Wirtschaft Rechnung tragen. Die Bildung der Treuhandanstalt am 1. März zielte genau in diese Richtung: nicht schnelle Privatisierung, sondern Sicherung und Modernisierung der öffentlichen AGs und GmbHs im Rahmen und unter Zuhilfenahme von Joint Venture-Vereinbarungen. Dies alles mit der Priorität: Stabilisierung der Versorgungslage.
In der Phase nach dem 9. November, als die Bürger der DDR in den Westen reisen konnten, war es zunächst so, dass sehr viel Geld in den Westen floss, da der Umtauschkurs in den Spitzen bis auf 1:20 hochging, und der Druck auf den inneren Markt zurückging. Nach dem 22. Dezember war die Grenze aber auch für BRD-Bürger offen, so dass das billige Geld in unseren subventionierten Markt zurückfloss. In der Regierung gab es dann auch heftigen Streit, welche Gegenmaßnahmen notwendig seien, um einen Ausverkauf zu verhindern. Eine der konkreten Maßnahmen war z.B., dass bestimmte Waren – unter Vorlage des Ausweises – nur an DDR-Bürger verkauft werden durften.
Jedenfalls ist es uns bis zum März gelungen, die Versorgung aufrecht zu erhalten; der Markt ist bis dahin nicht zusammengebrochen. Dies passierte erst im Vorfeld der Währungsunion, als massenhaft Waren verschwanden, weil z.B. die Bewertung der Waren im Lager völlig ungeklärt war. Auch daran sieht man, wie konzeptionslos die Regierungen de Maizière und Kohl an die Sachen herangingen.
Nun war ja auch die Regierung der großen Koalition anfangs mit einem durchaus eigenständigen Programm angetreten, ist dann aber schnell auf den Kurs der Bonner Regierung eingeschwenkt. Wie erklärst du dir den rabiaten Verfall der Politik de Maizières?
De Maizière gab am 18. April seine Regierungserklärung ab. Zu dem Zeitpunkt ging er davon aus, dass der Vereinigungsprozess sich zumindest noch über das ganze Jahr 1990 hinziehen würde, dass entsprechend auch eine eigenständige, DDR-spezifische Wirtschaftspolitik für diesen Zeitraum ausgearbeitet werden müsse. Dabei stellten sich jedoch zwei Probleme. Erstens der subjektive Faktor: Die Regierungsmannschaft hatte nicht nur kein Konzept, sie war auch fachlich unfähig, inkompetent ...
... z.B. der Wirtschaftsminister Pohle ...
Hinzu kam zweitens der immer stärkere Druck aus Bonn, nachdem dort die Entscheidung für den raschen Vollzug der Wirtschafts- und Währungsunion und den Entzug der Souveränitätsrechte der DDR in allen damit zusammenhängenden Fragen gefallen war. Historiker werden später vielleicht einmal rekonstruieren können, wie sich dieser Druck über die Bonner Berater, die letztlich die Politik in Berlin bestimmten, durchsetzte; nach außen wurde und wird das bis heute ja nicht sichtbar, das passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Volkskammer.
Ein Signal dafür, wie diese inkompetente Regierung falsche Politik machte, war für mich der Umgang mit der Treuhandanstalt. Im Juni, als sich die Lage der Unternehmen schon deutlich verschlechtert hatte, verfügte de Maizière, dass alle Kreditanträge der Betriebe auf 41% herabgesetzt werden, mit der schlichten Begründung, früher sei sowieso immer das doppelte gefordert worden, so dass jetzt weniger als die Hälfte dem realen Kreditbedarf entspräche. Wenn Leute mit derartigen Faustregeln Politik machen, muss man sich nicht wundern, dass es zu Massenarbeitslosigkeit kommt.
Muss man da nicht radikaler formulieren, dass die Bonner Regierung offensichtlich auch beim Regierungswechsel überhaupt kein Interesse hatte, eine sozialverträgliche Entwicklung zustande zu bringen? Schon beim Treffen der Regierungen Mitte Februar in Bonn war doch der überwältigende Eindruck, mit welcher Arroganz Kohl euch abkanzelte – nicht nur dich, sondern auch Eppelmann und Ullmann. Vielleicht hatte auch de Maizière diese Härte der Bonner unterschätzt.
Kohl hat alle unsere Vorschläge und Forderungen kategorisch abgelehnt, so auch den Vorschlag vom Februar, die BRD möge Bemühungen der DDR um Stabilität mit der Sofortmaßnahme eines Solidarbeitrages unterstützen. Nicht aus sachlichen Gründen, darüber hätte man im Streitfall verhandeln können; und die Vorhaltung, wir hätten die Daten nicht auf den Tisch gelegt, ist schlicht falsch. Kohl handelte von vornherein aus ganz einseitigen politischen Motiven. Ihm ging es nur darum, die Wahlen im März zu gewinnen. Deshalb das große Versprechen, bei entsprechendem Wahlausgang würde alles besser werden.
Auf dieses Versprechen setzte die Mehrheit der Bürger der DDR ihre Hoffnungen, auch de Maizière; auch er hatte die Illusion, dass dann die großen Hilfsprogramme bewilligt werden würden.
Doch das ist nicht passiert. Den Ausgang der Volkskammerwahlen wertete Kohl als seinen persönlichen Triumph, und das bestärkte ihn in seiner herablassenden Haltung auch gegenüber den neuen demokratischen Kräften, den Vertretern der Bürgerbewegungen, die er überhaupt nicht mochte.
Ich denke aber, dass auch Kohl und Haussmann große Illusionen hatten, dass sie ein sehr vereinfachtes Bild vom Vereinigungsprozess hatten. Sie meinten nämlich, auf politische Gestaltung weitgehend verzichten zu können, da das Kapital schnell und umfassend in der DDR investieren und der Mittelstand rasch expandieren würde. Die Probleme wurden von ihnen völlig falsch eingeschätzt.
Hinter der Bonner Politik steht also kein großes strategisches Konzept. Sie ist vielmehr durch spontanes Reagieren auf die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme gekennzeichnet. Klar ist nur: Kohl wollte den schnellen Anschluss, wie ökonomisch widersinnig und kontraproduktiv er auch ist.
Kohl ist seiner eigenen Ideologie aufgesessen, dass bei entsprechenden politischen Kräfteverhältnissen das Kapital im Selbstlauf die Wirtschaft umkrempeln und die Probleme lösen würde. Das war – wenn man so will – sein Konzept. Oder anders ausgedrückt: Er hatte gar keines.
Als das deutlich wurde, trat de Maizière die Flucht nach vorne an und rückte vom Dezember-Termin der Vereinigung ab, den er zuvor eisern vertreten hatte. Für ihn war eine Situation entstanden, in der er nur noch die Chance sah, wenn er zurecht kommen wollte, die Regierungsverantwortung spätestens zum Termin der Länderbildung an Kohl abzugeben.
Aber auch heute sehe ich noch nicht, dass Kohl und seine Mannschaft aus dem Schaden klüger geworden wären. Das einzige was man hört ist: Wir werden rechnen und die Höhe der Kosten sagen. Sie sagen nicht: Wir bilden einen Krisenstab, der tragfähige Konzepte erarbeitet. Insofern gehe ich davon aus, dass auch weiterhin nur spontan auf die Probleme reagiert werden wird, im Glauben, die Marktwirtschaft würde alles lösen.
Das Kapital verhält sich wie ein scheues Reh. Insofern ruht die Politik der Neokonservativen auf sehr brüchigen Säulen, ist also gar nicht so standfest, so unerschütterlich, wie viele meinen.
Und darin liegt ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, dass auch die Opposition – auch die PDS – die Situation nicht aufmerksam analysiert. Die Sozialdemokraten, die im Prinzip ein ganz anderes Gewicht haben könnten, belassen es bei einzelnen kritischen Anmerkungen und verfahren ansonsten nach dem Motto: Wir haben es vorausgesagt, ohne wirkliche Alternativen vorzulegen. Damit üherlässt die Opposition Kohl weiterhin das Feld der Offensive.
In Gegensatz zu deiner These vom konzeptionslosen und auch illusionären Charakter der Politik Kohls vertreten einige die Auffassung, hinter dem Crash-Kurs stünde ein strategischer Plan von Teilen des Staatsapparates und des Finanzkapitals.
Das ist zu einfach. Das Kapital agiert nicht geschlossen, nicht nach einer untereinander abgestimmten Strategie. In Japan könnte ich mir das schon eher vorstellen, da dort der Unternehmerverband immer auch als strategischer Zusammenschluss fungiert, aber nicht in der Bundesrepublik.
Aber unterhalb dieser Ebene der Gesamtstrategie, wenn es um sektorale oder punktuelle Fragen geht, ist es offenkundig. Das wird z.B. im Energiesektor oder im Versicherungsgewerbe deutlich. Aber das sind dann Einzelstrategien, daraus kann man kein globales Konzept ableiten.
Wir denken, dass man sogar soweit gehen kann zu sagen, dass die Politik nicht nur die Vorgaben gemacht hat, sondern dass dies z.T. auch gegen Optionen von Teilen des Kapitals durchgesetzt wurde. Deutlich wurde dies z.B. im Februar, als Pöhl [der damalige Bundesbankpräsident] von der Bundesregierung zum Kurswechsel gezwungen wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt waren u.E. große Teile des BRD-Kapitals auch bereit, ein längerfristiges Konzept mitzutragen.
Das lässt sich eindeutig belegen. Pöhl war ja 3 Tage, bevor unsere Regierungsdelegation am 13.2.1990 nach Bonn reiste, in Berlin und hat mit Kaminski, dem damaligen Bankpräsidenten, über Möglichkeiten der Zusammenarbeit verhandelt. Er ging also von einem längeren Prozess des Übergangs aus und äußerte sich auch entsprechend öffentlich – gegen eine schnelle Währungsunion, die er für ökonomisch schädlich hielt.
Nicht nur die Finanzfachleute, auch in der Industrie dachte man in größeren zeitlichen Abläufen und arbeitete dementsprechend an Übergangskonzepten. Das zeigte sich z.B. Anfang des Jahres bei einer Zusammenkunft in Rahnsdorf, bei der zahlreiche namhafte Konzerne aus der Bundesrepublik und Direktoren von DDR-Kombinaten vertreten waren. Christa Luft hielt dort einen Vortrag und erläuterte unsere Vorstellungen über Kapitalbeteiligungen. In dieser Runde war keine Rede davon, dass die Wirtschaft der DDR durch und durch marode, nicht sanierungsfähig sei, sondern dass es durchaus wettbewerbsfähige Sektoren, wie z.B. den Maschinenbau gab, wo sich Zusammenarbeit von West und Ost lohnt. Daimler-Benz oder auch Opel entwickelten damals ihre Vorstellungen, dass man sich längerfristig zu beteiligen denke. Das war die Lage bis zur Leipziger Frühjahrsmesse. Nicht das hat man gebündelt, sondern davon ist man weggegangen.
Wir denken auch, dass das Konzept deiner Regierung durchaus erfolgreich hätte sein können, wenn nicht der Druck aus Bonn dagegengestanden und die Bundesregierung einen anderen Kurs durchgesetzt hätte. Zumal das Interesse an ökonomischer Stabilität in der DDR auch dadurch zusätzlich motiviert wurde, die Handelsbeziehungen zu den anderen RGW-Staaten zu nutzen und auszubauen.
Doch der umgekehrte Effekt trat ein. Der Crash-Kurs gegenüber der DDR führte zur Verschärfung und Beschleunigung der Umgestaltungen in ganz Osteuropa, trug letztlich auch zur Gefährdung der Perestroika bei. Neben den ganzen innersowjetischen Problemen darf man u.E. diese internationalen Aspekte nicht ausklanmrern. Wenn der DDR ein zumindest mittelfristig eigenständiger Entwicklungsweg ermöglicht worden wäre, hätte auch der RGW eine Chance gehabt.
Das ist wahr. Die letzte RGW-Beratung am 9. Januar in Sofia stand vor der Frage, ob der RGW aufgelöst wird oder erhalten bleibt. Nach sehr kontroversen Debatten entschied man sich für Letzteres, obgleich es schon deutliche Bestrebungen gab, ich will nicht sagen, den RGW zu spalten, aber in Interessenbereiche aufzusplitten. Es sollte das große Thema der Marktwirtschaft angegangen werden, um zum Ende dieses Jahres so weit zu sein, dass ein großer Teil des Handels mit konvertierbarer Währung abgewickelt wird; zwischen Polen und der SU gab es entsprechende Absprachen. Von Seiten der CSFR wurde aber auch schon in aller Schärfe erklärt, dass man wieder dort ansetzen wolle, wo man 1948 aufgehört hatte – das war eine deutliche Aussage. Und konkret wurde angeboten, zwischen Polen, der CSFR und Ungarn einen eigenen Wirtschaftsraum zu bilden. Ferner wurde klar, dass die bis dahin gültigen Wirtschaftsheziehungen mit Cuha, Laos und anderen Staaten der so genannten Dritten Welt nicht mehr aufrechterhalten werden könnten, was nach Sofia auch umgehend umgesetzt wurde. Das Ergebnis läßt sich in Cuha z.B. deutlich ablesen.
Die Chance, das Konzept eines geordneten Übergangs in der DDR zu praktizieren, was auch für andere Länder hätte hilfreich und anregend sein können, wurde zunichte gewacht. Jetzt hört man überall nur noch den Ruf nach schnellem Übergang zur Marktwirtschaft. Auch in der SU. Aber bei den außenpolitischen Erfolgen der Perestroika und den großen Fortschritten bei der inneren Demokratisierung darf man nicht übersehen, dass das Hauptproblem von vornherein die Wirtschaft war und dass es bis heute nicht gelang, hierfür ein neues Konzept zu entwickeln. Während die Theoretiker immer neue Modelle schufen, bekamen die Pragmatiker die Wirtschaft aus den alten Gleisen nicht heraus – die Kluft zwischen beiden konnte nie überwunden werden. Es gibt eher einen Streit zwischen Persönlichkeiten als einen Streit um die Inhalte. Jelzin hat auch nichts anzubieten; er forciert nur, kritisiert, dass Versprechungen gemacht wurden, die nicht gehalten wurden. Das ist in Leningrad so, das ist in Moskau so. Diejenigen, die sich als konsequente Reformer bezeichnen, haben in Wirklichkeit keine Reformvorschläge – ihre Politik ist purer Populismus.
Damit kommen wir noch einmal zur Frage der politischen Offensive. Hättet ihr, wenn ihr sofort im November mit der Konstituierung der neuen Regierung offensiv das Ringen um die Mentalität der DDR-Bevölkerung aufgenommen hättet, nicht größere Chancen gehabt, dem Druck aus Bonn zu begegnen? Hätte nicht die Chance bestanden, offensiver um die Herzen und Hirne der DDR-Bürger zu kämpfen, die auf die D-Mark nicht länger warten wollten, sich sozusagen stärker ihrer subjektiven Befindlichkeit zuzuwenden? Zugespitzt: Habt ihr nicht zu lange gebraucht? Fehlten euch nicht anfangs auch die Konzepte, um nach den ganzen Wirrnissen der Zwischenphase Krenz in die politische Offensive zu gehen?
Ich halte daran fest, dass mit der Regierungserklärung vom 17.11. und dem darin enthaltenen Vorschlag der Vertragsgemeinschaft DDR-BRD eine Konzeption vorgelegt wurde. Bei meinem Treffen mit Kohl in Dresden am 19. Dezember gab es darüber eine gemeinsame Erklärung, in diesem Sinne zu verfahren. Unsere Grundorientierung war klar, wenn auch nicht in allen Einzelheiten ausgearbeitet. Und darin steckt in der Tat ein Problem: Es gab nur sehr wenige Leute, die Alternativen angedacht hatten. Von wissenschaftlicher, theoretischer Fundierung für die in der neuen Situation erforderliche Politik konnte keine Rede sein.
Die wissenschaftlichen Einrichtungen, die wir in der DDR hatten, die ja faktisch SED-Einrichtungen waren, haben eigentlich nur in den 50er und 60er Jahren an Alternativen gearbeitet. Das war die Zeit der Reformpolitik Chruschtschows. In der Ökonomie ging es damals um die Ausgestaltung eines neuen Systems von Planung und Leitung, mit dem auch Ulbricht experimentieren wollte, auch wenn ich damals bereits Kritik an seiner schematischen Herangehensweise hatte, am Versuch, die Überlegungen der sowjetischen Genossen möglichst pur zu übernehmen. Doch danach setzte eine Phase ein – unter Koziolek u.a. –, in der es nur noch darum ging, die herrschende Politik apologetisch zu rechtfertigen – das gilt für Otto Reinhold, selbst noch für Erich Hahn. Damit konnten wir, als es im November um die Ausarbeitung unseres Regierungsprogramms ging, überhaupt nichts anfangen, gar nichts.
Uns wurde zwar immer gesagt: Wenn ihr mal rankommt, holen wir die Konzepte aus der Schublade. Aber in den Schubladen lag nichts. Die einzigen, die wirklich an alternativen Denkmodellen arbeiteten, war die Gruppe um Dieter Klein, André und Michael Brie. Mit Dieter Klein war ich seit den 50er Jahren aus gemeinsamer FDJ-Zeit freundschaftlich verbunden. Meine Rede auf der ZK-Tagung im Dezember 1988 haben wir gemeinsam diskutiert, und auch mein Beitrag auf der 10. ZK-Tagung, der die Gegenposition zu Krenz umriß, ist in dieser Küche gekocht worden. Hervorheben möchte ich natürlich auch die Leute, mit denen ich in Dresden zusammengearbeitet hatte, und die Gruppe um Christa Luft an der Hochschule für Ökonomie. Aber das war es im Prinzip schon.
Und wie sieht das heute aus, in der bzw. im Umfeld der PDS?
Wir stecken ja noch mitten drin im Erneuerungsprozess. Und dabei sehe ich schon das Problem, dass uns jetzt auch teilweise das Hinterland fehlt. André Brie ist jetzt stellvertretender Parteivorsitzender, hat alle Hände voll mit den Wahlkämpfen zu tun, und Dieter Klein kämpft um das Überleben seines Instituts an der Humboldt-Universität, kann sich also auch nicht mehr so aktiv an der inhaltlichen Ausgestaltung des Erneuerungsprozesses beteiligen. Jedenfalls sind die Anstöße von außen derzeit sehr bescheiden, so dass man sich nicht wundern muss, wenn wir so schleppend vorankommen.
Das ist aber nicht nur eine Frage der aktiven Beteiligung, sondern auch unterschiedlicher, zunehmend auseinanderlaufender gesellschaftstheoretischer Positionen.
Auch das. Aber die zentrale Schwäche sehe ich darin, dass wir nicht mehr miteinander kooperieren. Es wird in der Partei nur unzureichend der Versuch gemacht, kontinuierlich organisatorische und theoretische Kompetenz im Zusammenhang zu erarbeiten. Nur so kommen wir aber zu konzeptionellen Alternativen.
Und diese konzeptionellen Schwächen führen dann dazu, dass sich auch in der LL[Linken Liste]/PDS in allen zentralen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen ein Streit zwischen Vertretern von Reformkonzeptionen und anderen, die den vermeintlichen Mangel an antikapitalistischer, sozialistischer Utopie beklagen, einstellt.
Genauso ist das, eine echte Schwäche. Ich hoffe, dass das, was von Klaus Steinitz u.a. an Konzeptionen und Positionsbestimmungen in jüngster Zeit erarbeitet worden ist, ein Ansatz für eine fruchtbare Weiterarbeit ist.
Und dann gibt es innerhalb der Linken auch ein nicht zu unterschätzendes Mentalitätsproblem. Du bist für dein Konzept »Deutschland einig Vaterland«, das du am 1. Februar vorgelegt hast, innerhalb der Linken heftig attackiert worden. Darin steckt nicht nur der irrwitzige Vorwurf, du hättest selbst noch nationalistischen Tendenzen Auftrieb gegeben, sondern auch das sehr praktische politische Problem, dass die Linke in ihrer derzeitigen Verfasstheit Kohl das Terrain weitgehend überlässt, statt ihn dahingehend anzugreifen, dass er sich nur national geriert, faktisch aber – wie du gesagt hast – eine Politik nationaler Verantwortungslosigkeit betreibt.
Meine Vorstellung von nationaler Verantwortung ist eine andere, als das, was in Teilen der Linken darunter verstanden wird. Als wir am 1. Februar 1990 die Regierung der nationalen Verantwortung bildeten, ging es darum, diejenigen Kräfte, die den demokratischen Umbruch in der DDR ausgelöst hatten, aktiv zu beteiligen und mit in die Verantwortung zu nehmen. Denn wer in einem solchen Maße Zustimmung findet wie der Runde Tisch, kann nicht in der Opposition bleiben, sondern muss verantwortlich mitgestalten.
Mit Nationalismus hat das nichts zu tun. Ich denke, dass nach wie vor viele innerhalb der Linken nicht sehen wollen, dass es nach dem 9. November keine Chance mehr gab, die DDR auf längere Sicht als selbständigen Staat gegenüber der BRD zu behaupten. Ich führte damals aus: »In diesem Sinne schlage ich einen verantwortungsbewussten nationalen Dialog vor. Sein Ziel sollte es sein, konkrete Schritte zu bestimmen, die zu einem einheitlichen Deutschland führen, das ein neuer Faktor der Stabilität, des Vertrauens, des Friedens in Europa zu werden bestimmt ist.« Mir ging es um einen geordneten Übergang zu einem neuen Deutschland, das weder nur DDR noch nur BRD ist, sondern etwas qualitativ Neues, Besseres. Und mir ging es darum, Vertrauen bei unseren Nachbarn zu schaffen, ihre berechtigten Ängste zu entkräften, auch dadurch, dass wir entschlossen den überall aufkeimenden Nationalismus zurückdrängen.
Also auch den neokonservativen »Nationalismus« als konzeptionslose Politik der Verantwortungslosigkeit zur Durchsetzung ganz egoistischer Interessen zu entlarven.
So ist es. Wenn wir immer nur auf die nationale Fassade eindreschen, mit der Kohl seine Politik ummäntelt, stoßen wir nicht zum Kern vor, verlängern letztlich nur die Geschichte. Was wir jetzt brauchen, ist ein breites Bündnis für ein wahrhaft neues Deutschland – ein Bündnis aller linken und demokratischen Kräfte, einschließlich der fortschrittlichen Kräfte der Kirche, der Sozialdemokratie, der Bürgerbewegungen. Eine Bewegung, die stark genug ist, sich den Konservativen entgegenzustellen.
Hans Modrow ist Ehrenvorsitzender der PDS. Er war bis 1989 Erster Sekretär der Bezirksleitung Dresden der SED und vom 13. November 1989 bis zum 18. März 1990 Vorsitzender des Ministerrats der DDR. Für Sozialismus diskutierten Joachim Bischoff und Hasko Hüning.