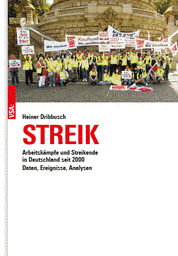Katja Kipping
Eine dialektische Geschichte
Wie aus PDS und WASG die neue LINKE entsteht
Beitrag im Supplement der
Zeitschrift Sozialismus 7-8/2014, S. 43ff.:
Alexander Fischer / Katja Zimmermann (Hrsg.)
Strategie einer Mosaik-Linken
Von WASG und PDS zu DIE LINKE.
und neuen Herausforderungen
56 Seiten | 2014 | EUR 5.00
ISBN 978-3-89965-978-8
(über den VSA: Webshop erhältlich)
Geschichte wird von großen Männern gemacht. Diese Vorstellung ist auch die vorherrschende Gründungsgeschichte der LINKEN, die gerne als die Geschichte zweier Männer erzählt wird. Aber auch wenn es etwas nativ ist zu glauben, dass ein kleiner Kreis lebenserfahrener Männer eine Parteigründung unter sich ausgefochten hätte, möchte ich nicht geschichtsphilosophisch werden. Unzweifelhaft aber hat der Austritt von Oskar Lafontaine aus der SPD und seine Ankündigung, nur dann für eine Kandidatur zum Bundestag bereit zu stehen, wenn sich die Parteien PDS und WASG auf eine gemeinsame Kandidatur zur kurzfristig von Gerhard Schröder ausgerufenen Neuwahl des Bundestags im Herbst 2005 verständigen, den Druck auf beide Parteivorstände enorm erhöht. Und ohne die klare Entscheidung von Gregor Gysi und des leider viel zu früh verstorbenen damaligen PDS-Vorsitzenden Lothar Bisky, dessen Rolle für die Gründung der gemeinsamen LINKEN wiederum gerne unterschätzt wird, in der PDS für einen neuen Namen zu werben, wäre es nicht zur Fusion gekommen. Denn man darf nicht vergessen, dass es damals sowohl führende Köpfe im Reformerlager wie in der Kommunistischen Plattform gab, die die Umbenennung der PDS in Linkspartei sehr kritisch gesehen haben.
Aber gerade heute, zehn Jahre nach der Gründung der WASG, halte ich es für angebracht, die gängige Geschichtsschreibung zu ergänzen. Denn nicht erst seit Marx wissen wir, dass die Geschichte eine Geschichte wirklicher Bewegungen ist, eine von sozialen Kämpfen und von den Widersprüchen der ökonomischen und politischen Verfasstheit einer Gesellschaft und nicht die von einsamen Staatsmännern oder -frauen bzw. ParteiführerInnen.
Wirkliche Bewegung
Ich habe das Entstehen der LINKEN von Anfang an aus nächster Nähe begleitet. Richtig ist: Einige Männer haben in entscheidenden Momenten die richtige Entscheidung gefällt – wie übrigens auch einige Frauen. Viel ausschlaggebender sind jedoch die gesellschaftlichen Prozesse, die dazu führten, dass die überall zitierten Männer überhaupt zu einem Punkt gelangen konnten, an dem sie vor diesen Entscheidungen standen.
Im konkreten Fall heißt das: Die Grundlage für das Entstehen einer neuen linken Partei wurde vor allem durch die sozialen Bewegungen geschaffen. Es waren die bundesweiten Protesttage gegen die Agenda 2010, die im November 2003 und im April 2004 deutlich machten: Es gibt erste Risse in der neoliberalen Hegemonie. Der Zeitgeist verändert sich. Neoliberale Deutungsmuster verlieren langsam ihre Deutungshoheit. Zu den wichtigen, leider oft ausgeblendeten Etappen auf dem Weg Richtung neue Linkspartei gehören vor allem die Europäischen Sozialforen und der Perspektivenkongress Mitte Mai 2004 in Berlin. Rund 1.500 Menschen kamen zu diesem Kongress, um über Alternativen zu Sozialraub und Privatisierung zu diskutieren. Auf dem europäischen Sozialforum im November 2003 in Paris trafen sich Linke, sozial Bewegte, engagierte ChristInnen und Angehörige von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), um sich für ein anderes Europa einzusetzen. Die Gewerkschaft ver.di ließ ihren Vorsitzenden Frank Bsirske zum Treffen der deutschen Gruppen am Rande des Europäischen Sozialforums einfliegen. Der Geist der Veränderung lag in der Luft.
Die Unzufriedenheit mit der Politik der rot-grünen Regierung hatte eine kritische Masse erreicht. Die PDS befand sich selbst in einer veritablen Krise. 2002 flog sie aus dem Bundestag. Es folgten heftige innerparteiliche Auseinandersetzungen, die in der Schärfe nur mit der Zeit vor dem Parteitag in Göttingen zu vergleichen sind. Zwar schaffte die PDS nach einem erneuten Führungswechsel (Lothar Bisky wurde wieder Vorsitzender) und einem guten Wahlergebnis bei der Europawahl 2004, sich wieder als politische Kraft zu etablieren, allerdings galt sie bei vielen als zu ost-zentriert: Keine Partei, die das Erbe der SPD antreten könnte.
Vor diesen Hintergründen breitete sich eine Stimmung aus, die nach einem neuen Akteur verlangte. Gemeinsam riefen Gewerkschaften und neue soziale Bewegungen am 3. April 2004 zu zentralen Demonstrationen gegen Sozialabbau auf. In Köln, Stuttgart und Berlin gingen eine halbe Million Menschen auf die Straße. Dieser Mobilisierungserfolg gab den Ausschlag, die Gründung der WASG in die Wege zu leiten.
Beim Europäischen Sozialforum in London im Oktober 2004 existierte sie dann bereits – die WASG in Gründung. Das Treffen der deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer war nicht nur geprägt vom Geist der Veränderung, sondern auch von heftigen Debatten zwischen WASG und PDS. Damals, im Herbst 2004, war an eine Fusion von WASG und PDS wahrlich nicht zu denken. Insofern sahen sich beide Parteien natürlich vor allem als Konkurrierende. Die PDS fragte, inwieweit die WASG wirklich eine linke Partei war: Schließlich reduzierte sie sich programmatisch auf eine Kritik an der Schröder-SPD; wichtige Themen linker Politik wie Antifaschismus oder der Kampf gegen den Überwachungsstaat spielten kaum eine Rolle. Und die WASG profilierte sich umgekehrt so manches Mal durch Kritik an der PDS, die zu ost-lastig sei und in Regierungsverantwortung Sozialkürzungen mittrage. Trotz aller Debatten erkannte man jedoch, dass sich die gesellschaftliche Stimmung nach links verschiebt. Unbeantwortet war da aber noch die Frage, welche AkteurIn diese Veränderung in der Parteienlandschaft umsetzen soll und kann.
Die Geschichte der neuen LINKEN ist auch undenkbar ohne die Geschichte der Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. Während die Gewerkschaften noch über Pläne für einen heißen Herbst redeten, versammelten sich mitten im Sommer 2004, landauf, landab, jeden Montag Menschen zu Demonstrationen. Es war gerade jene Bewegung der Unorganisierten in den kleinen Städten der Republik, die die Politik von Rot-Grün tief ins Mark traf und erschütterte. Keiner der üblichen Verdächtigen hatte diese Welle geplant. Menschen, die jahrelang nichts mit Politik zu tun hatten, gingen plötzlich Woche für Woche auf die Straße.
Sie beließen es aber nicht dabei, sondern kümmerten sich über die Grenzen ihrer Kleinstadt hinaus um eine bundesweite Vernetzung. Dabei trafen Menschen aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Junge Westberliner Antifa-Aktivisten begegneten Müttern aus dem brandenburgischen Senftenberg. Betagte Professoren, die schon viele Vernetzungstreffen erlebt haben, saßen neben Frauen, die zum ersten Mal in ihrem Leben Begriffe wie »quotierte Redeliste« hörten. Doch sie lernten schnell von einander, z.B. dass auf einer »quotierten Redeliste« jeder zweite Platz für Frauen vorbehalten wird, um zu verhindern, dass nur Männer reden.
Gelegentlich traten die unterschiedlichen Lebenswelten sehr deutlich zutage. So meinten bei einem Treffen in Leipzig ostdeutsche Erwerbslose, man müsse nun überall die Forderung nach kostenloser Schulspeisung für Kinder aus Hartz-IV-Familien stark machen. Die Montagsdemonstranten aus Westdeutschland konnten da nur staunen: Kostenlose Schulspeisung sei schön und gut, aber dazu müsste es in den Schulen erst einmal überhaupt so etwas wie Schulspeisung geben. Am Ende einigte man sich auf einen Forderungskatalog, der von Sofortmaßnahmen wie Angleichung des Regelsatzes für das Arbeitslosengeld II in Ost und West bis zu langfristigen Alternativen wie dem Bedingungslosen Grundeinkommen reichte.
Gerade in Ostdeutschland versuchten die Neonazis, die Montagsdemonstrationen für sich zu vereinnahmen. Da die meisten Beteiligten politisch recht unerfahren waren, lag darin eine substanzielle Gefahr für die noch junge Bewegung. Dass diese Vereinnahmung durch Neonazis nicht gelang, ist auch dem klugen Agieren antifaschistischer Gruppen zu verdanken. Sie erarbeiteten praktische Leitfäden für den Umgang mit Neonazis und halfen so, die Montagsdemos frei von der NPD und auch frei von rassistischen Ressentiments zu halten.
Innerhalb der entstehenden neuen Partei war der Wunsch zur Zusammenarbeit häufig stärker, als es das offizielle Fusionsprotokoll eigentlich erlaubte. Lange vor der eigentlichen Partei-Neugründung schlossen sich PDS- und WASG-Kreisverbände zusammen. Doch auch dort, wo man sich an den Zeitplan hielt, wurde – wie beispielsweise bei den Kommunalwahlen in Hessen – die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg zu einer Selbstverständlichkeit. Diese Spontanität und dieser Optimismus der Basis waren notwendig, weil auch nach der Bundestagswahl so manche Klippe umschifft werden musste. Ob die zentralen Akteure dies ohne den starken Rückenwind aus der Parteibasis geschafft hätten, bleibt zum Glück eine Frage, die nicht in der Realität getestet werden musste.
Neubegründung der LINKEN
Inhaltlich bot die Gründungsphase der LINKEN die Chance zu einer Neubegründung. Aber, trotz vielfältiger Debatten, konkreter politischer Beschlüsse und dem 2011 mit überwältigender Mehrheit beschlossenen Erfurter Programm, gilt es die inhaltliche Begründung linker Politik weiterzuentwickeln. Die gesellschaftlichen Umbrüche, die Ablösung der fordistischen Ära des Kapitalismus durch einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, die wachsende Bedeutung der Wissensproduktion und der Care-Ökonomie, wachsender Stress für die im Erwerbsarbeitsmarkt Tätigen bei gleichzeitig hoher Erwerbslosigkeit und die ökologischen Herausforderungen, die das kapitalistische Modell der Wachstumsökonomie radikal infrage stellen, führen in der gesamten politischen Linken dazu, dass wir den Prozess der Neubegründung nicht einfach beenden können. Ich will deshalb die zentralen inhaltlichen Momente der Neubegründung linker Politik umreißen, die DIE LINKE zwar schon in weiten Teilen in den wenigen Jahren seit ihrer Gründung geleistet hat, aber an denen wir dennoch gemeinsam weiter programmatisch arbeiten müssen.
1. Demokratie, Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit
DIE LINKE versteht sich ausdrücklich als Partei der sozialen Gerechtigkeit. Sie muss aber ebenso die Partei der Grundrechte und der Demokratie sein. Die Bedeutung der Grundrechte ist gerade aktuell wie selten zuvor. Die derzeitigen Ereignisse, wie die Überwachung der gesamten Bevölkerung durch die NSA, die Morde der NSU und die unheilvolle Rolle, die der Verfassungsschutz dabei spielte oder der Versuch, mittels Vorratsdatenspeicherung die Kommunikationsdaten aller BürgerInnen monatelang zu speichern, zeigen, wie notwendig eine Partei ist, die für Grund- und Freiheitsrechte eintritt und diese nicht gegen soziale Rechte stellt. Unsere Forderung nach Abschaffung aller Sanktionen im Hartz-4-Regime zeigt die Verbindung von sozialen Rechten und Bürgerrechten übrigens exemplarisch: Ein Grundrecht schränkt man nicht ein!
Als Partei der Selbstbestimmung, ist die Partei auch eine feministische Partei. Das drückt sich nicht nur in quotierten Listen bei der Wahl zu den Parlamenten, quotierten Parteiämtern oder in quotierten Redelisten bei Parteiversammlungen aus. Aber auch hier müssen wir selbstkritisch bleiben; wir haben in unserer Partei viel erreicht, aber es gibt noch einiges zu tun. Auch programmatisch. In der Forderung nach einem neuen gesellschaftlichen Zeitregime liegt durchaus das Potenzial, Fragen der Lebensführung von links her zu politisieren und Maßnahmen der sozialen Infrastruktur so kulturell einzubinden, dass sie auch tatsächlich eine anti-patriarchale Wirkung entfalten. Die letztlich entscheidende Frage stellt sich nun einmal – wie schon bei Marx – entlang der Arbeitsteilung und der Verfügung über die Zeit. Konkret geht es uns um die radikale Verkürzung der Arbeitszeit in Verbindung mit einer Umverteilung der verschiedenen Tätigkeitsformen zwischen den Geschlechtern. Dafür sind freilich politische Reformen erforderlich, aber ebenso eine kulturelle Revolution, die von der Zentralstellung der Erwerbsarbeitszeit abrückt. Solange 50-, 60- oder gar 70-Stunden-Arbeitswoche die Regel sind, sind Vereinbarkeiten unmöglich zu realisieren und werden auf das soziale Umfeld, etwa LebenspartnerInnen, abgewälzt – zumindest, wenn die Eltern pflegebedürftig werden oder die Kindererziehung ansteht.
Die Durchsetzung eines neuen gesellschaftlichen Zeitregimes wird aber ohne eine radikale Umverteilung der materiellen Ressourcen von Oben nach Unten nicht zu haben sein. Hier unterscheidet sich DIE LINKE von allen anderen Parteien. Wir sind die Partei, die das Vermögen der Millionäre besteuern und Einkommensgerechtigkeit – sowohl vorgelagert über einen 1:20-Einkommenskorridor als auch nachgelagert über eine Millionärssteuer – herstellen will. Aber wir dürfen unseren Gerechtigkeitsbegriff auch nicht nur auf die Einkommens- und Vermögensdimension reduzieren. Erst wenn wir ihn mit der Zeitdimension verbinden, bekommt er die notwendige gesellschaftliche Dynamik, die eine neue soziale Idee kreieren kann.
2. Globale Gerechtigkeit und eine Wirtschaftspolitik ohne Wachstumswahn
In der LINKEN hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die soziale Frage nicht mehr losgelöst von der ökologischen Frage gedacht werden kann – und umgekehrt. Zwar gibt es innerhalb der LINKEN immer noch Denkbarrieren, die im Sinne des konsequenten Klimaschutzes überwunden werden müssen. Dazu gehört etwa die Wachstumsideologie. »Schneller, höher, weiter«, der kapitalistische Komparativ, ist ökologisch gesehen nicht zum Nulltarif zu haben. Wachstum zielt immer auf ein quantitatives Mehr – und das ist niemals ökologisch neutral. Es kann durch technischen Fortschritt im besten Fall gebremst, aber nicht gestoppt werden. Wenn es um eine qualitative Weiterentwicklung geht, dann sollten wir nicht von Wachstum, sondern von Entwicklung reden. Insofern setzt der ökologische Umbau der Gesellschaft den Bruch mit der Wachstumslogik voraus. Diese Erkenntnis hat sich in Partei und Fraktion der LINKEN in der Debatte um einen »Plan B« erfreulicherweise durchgesetzt.
DIE LINKE ist auch die Partei der globalen Gerechtigkeit: Denn auf globaler Ebene treffen die Folgen der Klimakatastrophe zuallererst die Menschen in den ärmsten Ländern. Sie verfügen nicht über die finanziellen und technischen Mittel, um ihr Lebensumfeld anzupassen. Deshalb ist eine erfolgreiche Politik zur Klimarettung unabdingbar mit einer Politik der globalen Gerechtigkeit verbunden. Wir brauchen einen Red-Green-Deal, der aus folgenden Punkten bestehen muss: 1.) Globale Gerechtigkeit als Voraussetzung für eine globale Energiewende, 2.) eine Verkehrs- und Energiepolitik, die nicht zur Exklusion ganzer Bevölkerungsschichten führt, 3.) mehr Mitspracherecht der Betroffenen vor Ort bei der Planung und Durchführung von großen Infrastrukturprojekten, 4.) Konzentration auf Schrumpfung und Konversion statt Wachstumswahn.
3. Transformationsprojekte
Rosa Luxemburg schrieb vor rund 100 Jahren den Sozialisten ins Stammbuch, dass sozialistische Politik sich den existierenden Widersprüchen stellen muss. Konkret bedeutet das, »sowohl vom Standpunkt der bestehenden Gesellschaft selbst zu kritisieren, als auch ihr auf Schritt und Tritt das sozialistische Gesellschaftsideal entgegenzuhalten.« Rosa Luxemburg nennt das revolutionäre Realpolitik. Auch die heutige LINKE muss sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre Ziele umsetzen soll. Der Streit ist alt: Den einen, die vor allem auf die strukturellen Zwänge der kapitalistischen Gesellschaft verweisen und diese überwinden wollen, wird eine heilsartige Fixierung auf ein großes, fernes Ziel nachgesagt, während es über die ReformerInnen heißt, dass sie in ihrem pragmatischen Bemühen um kleinteilige Verbesserungen, die grundlegende Veränderung der Verhältnisse aus dem Auge verlieren und deswegen schnell auf den Weg der Anpassung geraten. Diesen klassischen Gegensatz der Parteien der Arbeiterbewegung haben wir in der LINKEN weitgehend produktiv überwunden, in dem wir Transformationsprojekte bestimmen, die sowohl über das Bestehende hinausweisen als auch die heutigen Lebensverhältnisse konkret verändern.
Ich will am Beispiel der Bedingungslosen Grundeinkommensbewegung erläutern, was ein Transformationsprojekt konkret von einer begrüßenswerten sozialen Reform unterscheidet (auch wenn ich weiß, dass es innerparteilich umstritten ist): Die Einführung des Grundeinkommens würde die Menschen von Existenzangst befreien. Insofern ist es erst einmal ein Ansatz, welcher die Lebenssituation im Hier und Heute verbessert. Darüber hinaus greift das Grundeinkommen eine entscheidende Voraussetzung der kapitalistischen Ausbeutung an – namentlich die Abhängigkeit derjenigen, die nicht über Produktionsmittel verfügen und nur ihre Ware Arbeitskraft anzubieten haben. Damit ist es auch ein revolutionäres Projekt.
Ein Bedingungsloses Grundeinkommen würde diejenigen, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen, zwar nicht völlig aus dieser Abhängigkeit befreien. Aber es würde sie in eine deutlich bessere Verhandlungs- und Gestaltungsposition versetzen. Sie wären nicht mehr zwingend auf den sofortigen Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen. So eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Mitbestimmung, für das Erstreiten ökologischer Standards und höherer Löhne oder besserer Arbeitszeiten. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass mit der Einführung des Grundeinkommens der Kapitalismus überwunden wird. Aber in einer Gesellschaft, in der ein Grundeinkommen erstritten wurde, sind die Voraussetzungen für eine grundlegende Transformation der Gesellschaft auf demokratische Art und Weise deutlich besser.
Wir sind, was die Formulierung solcher transformatorischer Projekte betrifft, nicht schlecht aufgestellt. Ich will nur einige Beispiele solcher Projekte stichwortartig benennen, die – obwohl sie als einzelne Forderung unter bestehenden kapitalistischen Verhältnissen realisiert werden können – dennoch einer anderen, postkapitalistischen Idee von Vergesellschaftung folgen: In der Energiepolitik streiten wir für eine dezentrale Energiewende, die die Macht der großen Energiekonzerne bricht und die Gewinne aus der Energieproduktion in den Städten und Gemeinden belässt; wir streiten für eine Ausweitung der Demokratie in den Betrieben, für das Recht zum politischen Streik oder für mehr Bürgerbeteiligungen; wir wollen, um der wachsenden Einkommensungerechtigkeit entgegenzutreten, dass die Gehälter der ManagerInnen gedeckelt werden, indem sie das 20-Fache der niedrigsten Gehaltsgruppe in ihrem Betriebe nicht übersteigen dürfen, und wir streiten für eine Strategie der radikalen Arbeitszeitverkürzung, in der wir bezahlte Sabbaticals für alle fordern.
Revolutionäre Realpolitik
Die Idee revolutionärer Realpolitik, die ihren Fixpunkt jenseits kapitalistischer Vergesellschaftung, die eine globale und umweltgerechte Perspektive hat und die auf die Stärkung sozialer und demokratischer Rechte zielt, müssen wir in unsere konkrete politische Arbeit übersetzen. Dabei wird DIE LINKE es in dieser Legislaturperiode nicht so einfach haben wie zur Zeit der zweiten Großen Koalition zwischen 2005 und 2009. War die Politik der SPD in der Gründungsphase der LINKEN noch darauf ausgerichtet, die neoliberalen Wünsche von Wirtschaft und Finanzmärkten im vorauseilenden Gehorsam umzusetzen (Stichworte: Rente erst mit 67, Erhöhung der Mehrwertsteuer), setzt sie in dieser Koalition offenbar auf eine moderate Korrektur des von ihr in ihrer Regierungszeit zwischen 1998 und 2009 zu verantwortenden Abbaus sozialer Rechte. Vor diesem Hintergrund genügt es nicht, der SPD nur die unsoziale Politik während ihrer Regierungszeit vorzuhalten. Im Gegenteil erleben wir, dass die SPD gegensteuert – wenn auch nur in Trippelschritten. Deshalb ist es nun dringender als zuvor geboten, dass DIE LINKE ihre »neue soziale Idee« – so der Claim aus ihrer Gründungszeit – nun auch wirklich ausformuliert.
Ein erster wichtiger Baustein dieser »neuen sozialen Idee« ist die Formulierung und der Kampf für eine Gesellschaft frei von Angst, also einer Gesellschaft, ohne prekäre Beschäftigung, krankmachendem Stress und hoher Erwerbslosigkeit.
Ein Drittel der Bevölkerung wird gegenwärtig von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt und in prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse abgedrängt. Dies ist Ausdruck des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus und der in den letzten Jahrzehnten erfolgten neoliberalen Verfestigung. In der Produktion erhärten sich Strukturen, die Kernbelegschaften, Werkverträge, LeiharbeiterInnen, SubunternehmerInnen, Outsourcing in ein flexibles Produktionssystem integrieren. Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne sachlichen Grund hat sich im 10-Jahreszeitraum mehr als verdoppelt und wird für junge Menschen nach der Ausbildung zur Regel, ebenso wie für Neueinstellungen. Noch viel weiter verbreitet sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor: Mini- und Midijobs, strukturelle Unterbeschäftigung (Teilzeit, Stundenverträge, usw.), befristete Arbeitsverhältnisse und auch hier die Zunahme von Werkverträgen sind inzwischen längst zur Regel geworden, und dienen der Lohndrückerei und verstärkten Ausbeutung der Beschäftigten. Selbst im öffentlichen Dienst wird prekäre Arbeit durch Outsourcing, Privatisierung und befristete Arbeitsverhältnisse verbreitet. In den Universitäten z.B. gehen befristete Arbeit und strukturelle Unterbeschäftigung Hand in Hand. In der Regel reduziert sich die Teilzeitbeschäftigung auf die Teilzeitbezahlung und übersteigt bei den Arbeitsstunden häufig eine geregelte Vollzeitbeschäftigung.
Die Einkommensposition und die Arbeitsbeziehungen der so genannten Mittelschichten geraten dadurch nachhaltig unter Druck. Der Stress am Arbeitsplatz nimmt laufend zu. Im neuesten DGB-Index »Gute Arbeit« geben 56% der Befragten an, sehr oft oder häufig gehetzt zu arbeiten, und 17% arbeiten sehr oft oder häufig außerhalb der bezahlten Arbeitszeit für ihren Betrieb. Den erschwerten Arbeitsbedingungen steht eine mittelmäßige Bezahlung vieler Beschäftigter gegenüber. 43% der Befragten gaben an, dass sie mit ihrem monatlichen Einkommen nicht oder gerade so über die Runden kommen.
Die wachsende Zahl der Soloselbständigen ist eine weitere Form prekärer Arbeitsverhältnisse – und sie bestehen nicht nur aus VersicherungsmaklerInnen und GrafikerInnen. Sie arbeiten als »selbständige« Köchinnen und Kellner in Restaurants und Hotels oder als Maurer und Malerinnen auf Großbaustellen. Unternehmen drängen ihre Beschäftigten oftmals in die Selbständigkeit, weil sie dabei erhebliche Kosten – insbesondere die Sozialversicherungsbeiträge – einsparen.
Besonders prekär ist die Situation von Flüchtlingen. Sie sind sowohl in der Wahl ihres Aufenthaltsorts, ihrer Bewegungsfreiheit und in der Möglichkeit, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, stark eingeschränkt. Psychisch belastend sind zudem unklare Aufenthaltsrechte und die damit verbundene Sorge vor Abschiebung.
Eine Folge der grassierenden Prekarität ist die Zunahme von psychischen Erkrankungen. Zum einen steigt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, zum anderen die der Zugänge in die Erwerbsminderungsrenten. So ist die Zahl der Rentenzugänge in eine Erwerbsminderungsrente aufgrund psychischer Erkrankungen im Zeitraum von 2000 bis 2010 um rund 80% angestiegen. Die gesellschaftlichen Kosten dieses Verschleißes von Arbeitskraft sind enorm.
Die verschiedenen Formen prekärer Arbeit führen in der Regel zu prekären Lebensverhältnissen. Die Zahl der Menschen, die aus der sozialen und kulturellen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ganz oder teilweise ausgegrenzt werden, erhöht sich durch Langzeiterwerbslosigkeit und Altersarmut. Auch hier verfestigt sich die prekäre materielle Lage von fast einem Drittel der Bevölkerung. Der materielle Mangel versperrt aber auch die kulturellen Lebensmöglichkeiten und begrenzt die Chancen, soziale Beziehungen einzugehen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, bis hin zu eingeschränkten Chancen LebenspartnerInnen zu finden, von den alltäglichen Schikanen ganz zu schweigen.
Solidarität herstellen
Trotz einiger Kurskorrekturen ist die Politik der Großen Koalition unsolidarisch gegenüber Ärmeren und Erwerbslosen. Wer sich wie die Große Koalition und die oppositionellen Grünen einer gesetzlichen Anhebung des Rentenniveaus verweigert, der ist mitverantwortlich für Altersarmut. Wer sich der Sanktionsfreiheit bei Hartz IV verweigert, der ist verantwortlich für die Schikane und Existenzangst von Erwerbslosen. Und während auch SPD und Grüne die Bevölkerung ganz unten einfach ausblenden, entlassen sie die oberen Klassen aus ihrer Solidaritätsverpflichtung. Gerade wenn es um die Besteuerung von Konzernen und Superreichen geht, werden alle anderen Parteien ganz zaghaft. Die SPD kuschte hier vor den Wünschen Angela Merkels, und die Grünen führen ihre »Wahlniederlage«, bei der sie immerhin ihr zweitbestes Wahlergebnis einer Bundestagswahl erzielten, auf ihre moderate Forderung nach Steuererhöhungen für Gutverdienende zurück (weshalb sie jetzt wie der Teufel das Weihwasser eine Politik der Steuergerechtigkeit scheuen). Diese Gesellschaft braucht aber eine couragierte Besteuerung von Konzernen und MillionärInnen, um die Renten zu sichern, in Bildung zu investieren, den sozialen Wohnungsbau zu beleben, die Energie- und Verkehrswende zu finanzieren, und um Mindestsicherung und Mindestrente durchzusetzen.
Die Mittelschichten können ihren Status nur halten, wenn die oberen Klassen ihren Beitrag leisten. Das kann aber nur durchgesetzt werden, wenn sich die mittleren Schichten nicht von denen abgrenzen lassen, denen es nicht so gut geht. Wir erleben, wie Hartz IV und befristete Beschäftigung Druck auf die Einkommen der mittleren Schichten ausübt. Die Angst vor dem repressiven Hartz-IV-System bringt viele Menschen dazu, schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne zu ertragen. Höhere Regelsätze und die Abschaffung der Sanktionen sind also nicht nur Wohltaten für Hartz-IV-Beziehende. Sie stärken auch die Durchschnittsverdienenden. Deshalb setzen wir auf eine Politik der realen Solidarität: Wir wollen die Perspektiven der mittleren Schichten verbinden mit denen der prekär Beschäftigten sowie der Erwerbslosen. Diese Politik müssen wir allerdings gegen die oberen Klassen, gegen die Banken und Konzerne durchsetzen. Das können wir als LINKE natürlich nicht alleine. Dazu braucht es auch die Selbstermächtigung der Vielen, die Gewerkschaften, die Umweltverbände, die sozialen Bewegungen.
Die konkrete Aufgabe der LINKEN in den kommenden Jahren lässt sich also so formulieren, dass wir die Reformulierung der »sozialen Idee« verknüpfen müssen, mit einer Politik der Umverteilung, die die prekären und die mittleren Klassen in der Gesellschaft verbindet, die den Kampf gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse führt und sich für eine gerechtere Verteilung der Zeit einsetzt. Zu diesen strategischen Fragen werden interne Verständigungen genauso notwendig sein, wie die solidarische Diskussion mit sozialen Bewegungen und Gewerkschaften sowie harte politische Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern. Dass wir als LINKE diese Herausforderung annehmen können, ist Ergebnis der erfolgreichen Vereinigung von PDS und WASG, auf die alle, die daran mitgewirkt haben, ein wenig stolz sein dürfen. Ich jedenfalls bin es.